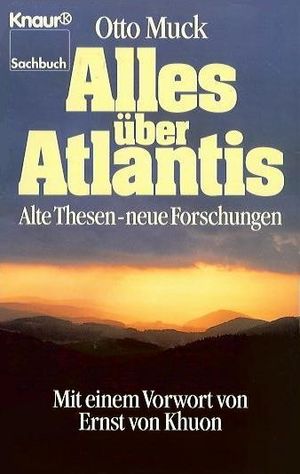Rätsel Atlantis
Ein Vorwort zu: Otto Mucks 'Alles über Atlantis' (1976)
von Ernst von Khuon
So sah ich es vor mir: Mehrere verkrustete Amphoren standen an die Bootswandungen gelehnt nebeneinander. Sie waren noch naß, eben erst geborgen. Zwei der Amphoren schienen - und das nach ein paar tausend Jahren! - intakt, waren noch immer verkorkt und versiegelt. Sie werden Olivenöl oder Wein enthalten, dachte ich; er wird längst verdorben sein. Der Taucher in seinem schwarzen Gummianzug richtete sich auf; er gab den Blick frei auf Wertvolleres: Da lag der Kopf eines griechischen Jünglings, grün patinierte Bronze. Die Augenhöhlen nicht leer, das Weiß des mit Perlmutt eingelegt, die braune Iris aus einer Muschelschale geschnitten, das glänzende Schwarz der Pupille aus Obsidian, vulkanischem Glas, gefertigt. Neben dem Kopf lag, ebenfalls vom Edelrost grün gefärbt, ein zusammengedrücktes, irgendwie zusammengebackenes Stück Maschine, ein Räderwerk wie aus einer großen Uhr. Ich erinnere mich sehr gut der Gefühle, die mich beim Betrachten dieser Dinge überfielen, der Bewunderung für den wertvollen Kopf, der Freude, die werkartige Maschine wiederzuerkennen. Doch kam etwas Ärger hoch; offensichtlich war ich zu spät gekommen, hatte die eigentliche Bergung nicht miterlebt. Ich muß mein Bedauern wohl auch ausgedrückt haben, denn nun drehte sich der Taucher mir zu. Er öffnete bedeutungsvoll die Hand und ließ mich einen kleinen Goldbarren sehen, wortlos, aber so, daß ich sofort bemerken sollte, das andere sei dagegen unbedeutend, vergleichsweise wertlos. Das Gold sah aus wie aus einem Schaukasten der Bank, Anstelle des Stempels, der Gewicht und Feingehalt bestätigt, waren seltsame Zeichen eingeprägt, die mir bekannt vorkamen. Irgendwie erinnerte mich der kleine Goldbarren an Grundsteinlegungen, bei denen Münzen und eine Tageszeitung eingemauert werden. Was für ein unerhörter, großartiger Zufall! So ist man also, dachte ich, auf Anhieb bis in das Innerste der Königsstadt Basileia, auf den Schatz im Poseidon-Tempel gestoßen. Ich versuchte, Zeit und Datum des Ereignisses festzustellen, und muß mit der Bewegung zur Armbanduhr - aufgewacht sein. Es war kurz nach 5 Uhr; um halb sechs wollte ich aufstehen. Am Tag zuvor, dem 17. April 1972, waren wir mit dem Schiff auf Thera angekommen, hatten unsere Geräte und Koffer nach Phira hochbringen lassen, um im »Atlantis« die vorbestellten Zimmer zu beziehen. Vom Fenster aus sah man auf die Caldera, den vom blauen Meerwasser erfüllten Einbruchkessel, den einstigen Hauptkrater des Santorin, aus dessen Mitte der Vulkan einen neuen Kegel, die Insel Nea Kameni, hervorgetrieben hatte. Alle paar Jahre quoll dort glutflüssiges Magma hoch, ließ der Vulkan nachzuckend die Erde beben. Eine ferne Erinnerung an jenen furchtbaren Ausbruch, der nach einer vieldiskutierten Theorie den eigentlichen Untergang von Atlantis bedeutete.
Was den Traum anlangt, mit dem ich aufwachte, so waren seine Einzelheiten keine "übersinnlichen" Eingebungen, nichts weniger als das, vielmehr die lebhafte Erinnerung an Eindrücke, die ich kurz zuvor in Athen und Jahre zurück anderswo erfahren hatte. Die Amphoren im Boot waren an Jacques-Yves Cousteau gebunden, den ich schon 1953 kennenlernte, als er in München Buch und Film »Die schweigende Welt« vorstellte. Wir unterhielten uns über die von ihm erfundene »Aqualunge«, ein auf den Rücken zu schnallendes Preßluftgerät, mit dem sich frei und unabhängig tauchen läßt; wir sprachen über den Tiefenrausch, über die Chancen der Schatzsucher, die Möglichkeiten der Unterwasser-Archäologie. Ob er nicht schon daran gedacht hätte, nach den Resten von Atlantis zu suchen, fragte ich ihn zum Abschluß unseres Radiointerviews. Er antwortete diplomatisch: Daran gedacht wohl, aber das sei ein Thema, mit dem man rasch in den wissenschaftlichen Streit der Fachgelehrten gerate. Immerhin ein faszinierender Gedanke, sagte Cousteau, vielleicht später einmal. Es scheint, daß Cousteau das Thema Atlantis nicht aus den Augen verloren hat. Gerade jetzt, als ich dies schreibe, wird mir eine Ankündigung des Deutschen Fernsehens auf den Tisch gelegt. »Der 65Jährige Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau hat sich dem Projekt Atlantis zugewandt. In der Ägäis - vornehmlich um Santorin - werden er und sein 30köpfiges Team nach den Überresten des sagenumwobenen Atlantis tauchen und sich mit den Atlantis-Theorien von Jürgen Spanuth (Helgoland), mit den angenommenen >Fundorten< Azoren, Bimini (Florida), Lanzarote (Kanarische Inseln) und Atlas-Gebirge (Marokko) auseinandersetzen.«
Was die anderen Fundstücke im Traumboot betrifft, so waren sie mir kurz zuvor im Athener Nationalmuseum begegnet. Den Jüngling mit den eingesetzten Augen hatten Schwammtaucher aus einem in 60 Meter Tiefe liegenden Schiffswrack vor der griechischen Insel Antikythera geborgen wie auch jenes Zahnräderwerk, die sogenannte »Maschine von Antikythera« [1], die bei meinem Besuch noch nicht öffentlich zugänglich gemacht war, mir aber wunschgemäß aus dem Depot in ein kleines Nebenzimmer gebracht wurde. Ein zweites Gerät dieser Art ist bisher noch nicht gefunden: eine Art Uhrwerk; man kann die Räder noch gut erkennen; am größten zählt man 240 exakt gearbeitete Zähne. Vielleicht ein Tachometer, mit dem Wegstrecke und Geschwindigkeit des Schiffs gemessen wurden? Eine Inschrift erweist, daß die Maschine aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. stammt. Ein weiterer Beweis dafür, daß unser Wissen über die Antike noch immer lückenhaft ist. Man hat bisher so gut wie nichts von einer Zivilisation gewußt, die Maschinen solcher Art herzustellen in der Lage war. Wie weit reicht diese Technik tatsächlich zurück? Wo wurde sie ursprünglich entwickelt?
Was schließlich die geträumten Schriftzeichen auf dem kleinen Goldbarren anlangt, so haben sie mich an den berühmten Diskos von Phaistos erinnert, eine Tonscheibe von 16 cm Durchmesser, die im Museum von Iraklion auf Kreta in einem Kasten aus Panzerglas aufbewahrt wird. Die Zeichen auf dem Diskus sind nicht etwa mit einem Griffel eingeritzt, sie sind gestempelt. Die Herstellung solcher Stempel, eine Vorwegnahme der Drucklettern des Gutenberg, zeigt an, daß man den Text in Serien fertigen wollte. Eine Bilderschrift, die noch nicht entziffert ist. Man hat bisher kein Gegenstück gefunden. Es könnte ein Jahreskalender für die Schiffsbesatzungen der Seevölker gewesen sein, so lautet ein plausibler Lösungsvorschlag, eine Art Bilder- und Lesebuch für die Matrosen. Andere haben eine rhythmische Gliederung des Textes zu entdecken geglaubt, ein zweistrophiges Gedicht zu je 10 Versen, vielleicht magisch-religiösen Inhalts? Es könnte ein Zusammenhang mit Atlantis bestehen, zumal das wohl auffälligste der eingestempelten Schriftzeichen den Kopf eines Mannes mit einem Federhut, einer sogenannten »Strahlenkrone« darstellt. Jürgen Spanuth, der streitbare Pastor von Bordelum in Nordfriesland, der Atlantis bei Helgoland lokalisiert und die Nordvölker nach verheerenden Sturmfluten auf ihrer »großen Wanderung« bis an die Grenzen Ägyptens gelangen läßt, verweist auf die Wandbilder in Medinet Habu, an dem Palasttempel des dritten Ramses (1200-1168 v. Chr.) gegenüber Luksor. Da ist der Pharao im Kampf mit den Kriegern der Seevölker dargestellt; sie tragen diese dekorativen »Federkronen«. Auch der Ruderer, der auf einem bei Bremen gefundenen bronzezeitlichen Rasiermesser abgebildet ist, trägt diese Kopfbedeckung; man findet sie auch auf skandinavischen Darstellungen, ein für Spanuth zählendes Indiz. Seltsamerweise ist das ganze Schiff auf dem Bremer Fundstück mit solchen »Strahlen« bepelzt; man könnte es auch als stilisiertes Elmsfeuer deuten.
Es war 1969, als J. V. Luce, Professor in Dublin, die Hypothese aufgriff, Atlantis müsse in der Ägäis gelegen haben. Seinem Buch »Atlantis - Legende und Wirklichkeit« schickte Sir Mortimer Wheeler, einer der großen alten Männer der Archäologie, ein bemerkenswertes Vorwort voraus. Darin lesen wir: »Schon 1909 hatte ein junger Gelehrter aus Belfast den geistvollen Gedanken geäußert, im sagenumdunkelten Staat der Atlanter habe man nichts anderes als die Erinnerung an das strahlende minoische Reich vor sich, dessen Glanz damals dank der Arbeiten Sir Arthur Evans' und anderer Pioniere der Welt bewußt zu werden begann.« Der junge Gelehrte war K. T. Frost. Seine Vermutung wurde damals kaum beachtet. Sir Mortimer Wheeler nennt die Athener Schlüsselfiguren, denen es beschieden sei, »dem sagenhaften Bericht Aktualität zu leihen und Wesentliches zur Rekonstruktion des Bildes beizutragen«, die Professoren Marinatos und Galanopoulos.
Inzwischen war nämlich Spiridon Marinatos, der Generalinspekteur für griechische Altertümer, auf Thera-Santorin in überaus glücklicher Weise fündig geworden. Nahe von Akrotiri im Süden der Insel hatte er eine minoische Stadt ausgegraben, die wie Pompeji von vulkanischen Auswurfmassen begraben und damit konserviert wurde. Skelette wurden nicht gefunden, weder Münzen noch Schmuck, keine transportablen Kostbarkeiten. Die Menschen waren vermutlich durch Erdstöße gewarnt worden. Sie hatten die Stadt schon verlassen. Man hat den Kalkputz, der von den Wänden gefallen und in kleinste Stückchen gebrochen war, wieder zusammengesetzt und die schönsten der Wandmalereien ins Athener Nationalmuseum gebracht: ein Lilienzimmer mit Schwalbenpärchen, Zimmer mit den Bildern boxender Knaben, afrikanischer Antilopen, blauer Affen. In dieser Umgebung gab mir Professor Marinatos ein Fernsehinterview. Er sprach Deutsch, eigentlich fließend, wenn auch mit kleinen grammatikalischen Fehlern. Wörtlich: »Sie wissen ja, daß nach der Heiligen Schrift die meisten Bücher über das Thema Atlantis erschienen sind. Atlantis ist eine Frage, die elektrisiert, die große Menge, das Publikum, und die gebildeten Leute auch. Nun: Ich würde gern annehmen, daß die Explosion und die Vernichtung der kleinen Insel von Santorin den Anlaß gegeben hat zu der Kreation dieser Legende, daß eine große, glückliche, reiche Insel vernichtet sei. Zusammen mit Santorin wurde auch Kreta vernichtet, und die Ägypter hatten Kreta vor Augen. Das Weitere aber, eine echte, wirkliche Insel mit all diesen politischen und technischen Installationen, das ist, glaube ich, der Phantasie von Platon entsprungen. Platon hatte immer eine Idee, das Wort Idee stammt von ihm, die Welt der Ideen ist platonisch. Platon hat die Idee geschaffen von einem idealen Staat, die Idee auch von Atlantis.«
Später, als ich ihm das Mikrofon abgenommen hatte, fragte ich ihn, ob man Atlantis nicht auch anderswo finden könne, bei Helgoland oder bei den Azoren. »Warum nicht«, meinte er, »man wird hier und dort nach den glücklichen Inseln suchen und vielleicht die Reste von Kulturen finden, die da untergegangen sind. Bei den Azoren? Auch dort könnte Atlantis, ein Stück Erinnerung an das verlorene Paradies sein. Vielleicht werde ich selbst einmal ein Buch über Atlantis schreiben.« Dazu ist es nicht mehr gekommen. Im Oktober 1974 kam die Nachricht, daß der inzwischen 73jährige kurz vor Abschluß der Grabungssaison bei Akrotiri von der einstürzenden Mauer eines unter seiner Leitung freigelegten minoischen Palastes erschlagen wurde. Am Tag nach dem Marinatos-Interview empfing mich Professor Angelos Galanopoulos in seinem seismologischen Observatorium auf einer kleinen Anhöhe zu Füßen der Akropolis. Für ein Gespräch vor der Kamera sei sein Englisch zu schlecht, ansonsten stehe er zur Verfügung. Nun, wo Marinatos Zusammenhänge zwischen dem Ausbruch des Santorin und der Erzählung des Platon sah, die Anregung, den Zündfunken, das Material für eine Parabel, war Galanopoulos sehr viel bestimmter. Für ihn war - so seine 1960 erstmals aufgestellte Hypothese - die Vulkaninsel Thera-Santorin mit der Königsinsel von Atlantis identisch. Atlantis sei dort um 1500 v.Chr. untergegangen. [2]
Galanopoulos diskutierte freimütig die »schwachen Stellen« seiner Theorie, von denen hier nur zwei angeführt werden sollen: Daß Platon von einem Atlantis außerhalb des Mittelmeers berichtet habe, könnte ein Mißverständnis sein, meinte er. Es sei vorstellbar, daß mit den »Säulen des Herakles« nicht Gibraltar, sondern die Südspitze der Peloponnes, Cap Matapan und Cap Maleas, gemeint waren. Daß der Untergang von Atlantis nach der Schilderung Platons 9000, nicht 900 Jahre vor Solon stattgefunden habe, könnte falsch verstanden sein, in diesem Fall schon von Solon. Der habe die ägyptischen Zeichen möglicherweise falsch gelesen, den ägyptischen Priester falsch verstanden. Noch heute gibt es ähnliche Rechenschwierigkeiten: Für den Europäer sind 1000 Millionen = 1 Milliarde, für die Amerikaner one billion. Daß die Behauptung des ägyptischen Priesters »Bürger, die vor 9000 Jahren gelebt haben« mit Sicherheit falsch sei, betont auch Jürgen Spanuth. »Phantastische Datierungen sind in der antiken Literatur häufig.« Aber das bedeutet eben doch, daß nur das wortwörtlich von Platon übernommen wird, was in eine Theorie hineinpaßt, Widersprüchliches als Mißverständnis oder als Übermittlungsfehler erklärt werden muß. Ich bin damals nicht ganz befriedigt von Prof. Galanopoulos fortgegangen. Man hat mir später gesagt und geschrieben, er habe sich inzwischen von seiner Theorie selbst distanziert. Damals und mir gegenüber tat er das jedenfalls nicht. Hätte er mir sonst sein Buch, in dem er seine Thesen vertrat, mit einer persönlichen Widmung geschenkt?
Galanopoulos sah sich von James W. Mavor bestätigt, einem hervorragenden Ingenieur und Ozeanographen, der mit der »Alvin« in die Ägäis einlief, jenem amerikanischen Schiff, mit dem es gelungen war, die vor der spanischen Küste verlorengegangene H-Bombe aufzufinden und zu bergen. Freilich hat auch Mavor, der 1969 seine beiden Expeditionen in dem Buch »Reise nach Atlantis« beschrieben hat, nur auf der Hypothese von Galanopoulos aufbauen und die letzten Grabungsergebnisse von Marinatos einbeziehen können, jedenfalls kein direktes Beweisstück aufzufischen vermocht.
Spanuth kanzelte die Bücher von Luce und Mavor entsprechend ab. [3] Sie enthielten »grobe Denkfehler, zahlreiche unzulässige Umdeutungen, falsche Angaben und unrichtige Behauptungen, die das sogenannte >Weltereignis<, Atlantis in der Ägäis gefunden zu haben, in ein Nichts zergehen lassen«. Abermals ortet Jürgen Spanuth sein Atlantis folgendermaßen: Die Königsinsel läge nach den Angaben Platons »in der Mündung großer Flüsse« (Weser, Elbe, Eider), im Schütze »eines Felsen, der sehr hoch und steil aus dem Meer aufstieg, rotes, weißes und schwarzes Gestein enthielt« (Helgoland), wo die Atlanter Kupfererz, gediegenes Kupfer und Oreichalkos (wahrscheinlich Bernstein) gefunden hätten. Der, wie bei Platon angegeben, exakt 50 Stadien (das sind 9,2 km) hinter dem Felsen liegende Berghügel sei der »nun unterseeische >Steingrund<-Hügel, auf dem man vor 30 Jahren schon die Reste eines germanischen Heiligtums entdeckt« hätte. »Hier lag einst die [ Basileia].« Spanuth faßt zusammen: »Der Atlantis-Bericht ist also kein Bericht von der Blütezeit der minoischen Kultur, sondern ein Bericht von der Blütezeit der nordischen Kultur der Bronzezeit, die durch die Naturkatastrophen seit etwa 1250 v.Chr. und die dadurch ausgelöste Abwanderung großer germanischer Bevölkerungsteile aus dem Raum Norddeutschland, Dänemark, Skandinavien beendet wurde. Der Atlantis-Bericht ist eine Germania aus der Bronzezeit.«
Nimmt man Platon hinsichtlich der Ortsangabe für Atlantis beim Wort, müßte man es jedenfalls außerhalb des Mittelmeers, jenseits von Gibraltar (»außerhalb der Säulen des Herakles«) suchen, im Atlantischen Ozean also. Spanuth weist aber darauf hin, daß der Atlantische Ozean (wie ihn Athanasius Kircher Anfang des 17. Jahrhunderts nannte, eben weil er Atlantis dort vermutete) nicht mit dem Okeanos, dem Atlantischen Meer der antiken Autoren verwechselt werden dürfe. Die hätten darunter nicht das Meer zwischen Europa-Afrika einerseits und den beiden Amerika andererseits verstanden, sondern das Meer, in dem sie Atlas, den Himmelsträger, suchten, und das sei in griechischen Texten immer wieder der Norden (in einem Bernsteinland) gewesen.
Auch Adolf Schulten, der berühmte Erlanger Archäologe, der sein ganzes Leben der Erforschung des antiken Spanien widmete, hat Atlantis außerhalb der Säulen des Herakles gesucht, allerdings relativ nah hinter Gibraltar, unweit Sevilla, an der Mündung des Guadalquivir. Irgendwo dort lag einstmals Tartessos, eine der reichsten Städte des Altertums, und nach der Meinung des Archäologen Schulten war eben dieses Tartessos, nach dem er jahrelang gegraben hat, das von Platon so genannte Atlantis. Atlas hieß der älteste König von Atlantis, und sein Zwillingsbruder habe sich in der Sprache des Landes Gadiros genannt, was auf Cádiz hinweise. Vieles, was Platon über Atlantis berichtet, über seinen Hafen, über den Kanals zum offenen Meer, wäre mit der Lage im Mündungsdelta des Guadalquivir erklärt. Auch der Reichtum von Tartessos (= Atlantis), der aus dem Silber der andalusischen Berge resultierte und dem Kupfer der Rio-Tinto-Gruben, das durch den Zusatz von Zinn zur Bronze gehärtet wurde. [4] Leider hat Schulten, der Anfang dieses Jahrhunderts das Numantia der Iberer und die 7 Feldlager des Scipio (185-129 v.Chr.) ausgrub, Tartessos nicht finden können. Vielleicht war Tartessos das heutige Sevilla, kommt eines Tages bei Ausschachtungsarbeiten für irgendein Hochhaus das Schultensche »Atlantis« ans Licht.
Natürlich steht am Anfang aller Theorien und Hypothesen die Frage: Ist die Atlantis-Erzählung ein geschichtlicher Report, möglicherweise dichterisch ausgeschmückt, ähnlich der homerischen Ilias, nach der Heinrich Schliemann Troja suchte und fand? Oder ist sie reine dichterische Erfindung, ein Märchen, eine von Platon absichtsvoll so in die Welt gesetzte Geschichte? Platon betont zwar ausdrücklich, seine Geschichte sei wahr. Gerade das könnte aber ein schriftstellerischer Trick sein, die Wirkung des Erzählten zu erhöhen. Zu denken gibt immerhin, daß für Aristoteles, den berühmten Schüler Platons, Atlantis eine poetische Fiktion gewesen ist: »Der Mann, der träumte, ließ sein Traumbild auch wieder zerrinnen.« [5] Wenig später (um 300 v.Chr.) kommentiert dann Krantor von Soloi die Erzählung des Platon und betont, sie sei Wort für Wort die historische Wahrheit. Es scheint, daß der Kommentator die ägyptischen Quellen selbst überprüft hat; die Berichte seien noch an den Pfeilern zu sehen. Freilich, wann wären Denkmalstexte je wörtlich zu nehmen? Wie oft sind durch Generationen weitergegebene, durch Hörensagen übermittelte Nachrichten unbeabsichtigt verändert worden! Und nicht selten geben für die Nachwelt bestimmte Aussagen die Fakten geschönt, propagandistisch gefärbt wieder. Gerade in |Ägypten hat man auf diese Weise »Geschichte« verändert, gelöscht und erfunden, Niederlagen vertuscht, schwächliche Pharaonen verherrlicht, die Bildnisse und Namen von Vorgängern weggekratzt, um sie für alle Zeiten auszulöschen. Wie auch immer man die Glaubwürdigkeit der Texte einschätzen will, auf die sich Platon beruft, alle Überlegungen zum Rätsel Atlantis bewegen sich zuerst und zunächst zwischen diesen beiden Polen: Ist Platons Erzählung bloße Erfindung oder ein Tatsachenbericht?
Nur wer vom Tatsachenbericht ausgeht, wird hoffen dürfen, wirklich und wahrhaftig Atlantis zu finden. Daß diese abenteuerliche Erwartung in die Träume der spanischen und portugiesischen Seefahrer einging, ist sicher. So ist das zugespitzte Wort J.O.Thomsons zu verstehen, in gewisser Weise könnte Platon als »der Entdecker Amerikas« gelten. So wird denn auch in einer »Historie der Indianer« - rund 60 Jahre nach der Entdeckung durch Kolumbus - die Auffassung vertreten, die transatlantischen Kontinente seien Atlantis. Warum, so kurz danach ein Vorschlag, nicht einen der Kontinente Atlantis nennen? Später taucht der Gedanke auf, die Kanarischen Inseln oder die Azoren müßten Atlantis sein. Über diese Brücke hätten die Kulturen diesseits und jenseits des Atlantik miteinander korrespondiert. Ja, es sei Atlantis gewesen, das diese Kulturen gepflanzt habe. Athanasius Kircher (1601-80), der gelehrte Jesuit, der sich auch mit Hieroglyphen und der Laterna magica befaßte, war der Meinung, Atlantis wäre im Gebiet der Azoreninsel St. Miguel zu finden. In etwa dort hakte dann 200 Jahre später (1882) der Amerikaner Ignatius Donnelly ein: Der sogenannte Delphinrücken, eine untermeerische Erhebung im Azorengebiet, müsse das abgesunkene Atlantis sein. Donnellys Buch »Atlantis - The Antediluvian World« kam in nicht ganz hundert Jahren auf mindestens 50 Auflagen. Der Autor hatte einen fabelhaften Sinn für Publizität. Er war Mitglied des Kongresses; er bewarb sich zweimal, allerdings vergeblich, um das Amt des Vizepräsidenten. Weltweite Aufmerksamkeit erregte seine »Entdeckung«, die Werke Shakespeares seien in Wirklichkeit von Sir Francis Bacon geschrieben. Das alles mag die schillernde Persönlichkeit, den hochintelligenten und einfallsreichen Donnelly hinreichend charakterisieren. Der von ihm aufgegriffene Grundgedanke, Atlantis auf dem Delphinrücken zu lokalisieren, konnte dennoch richtig sein, und in der Tat ist dieser Gedanke auch bis zum heutigen Tag lebendig geblieben.
Was bei Donnelly fabelhaft-unbewiesen klingt, hört sich in der Sprache der Naturwissenschaften, die auf die Möglichkeiten moderner Meeresforschung hinweisen kann, ganz anders an. 1954 kam dann das erste Atlantisbuch von Otto H. Muck heraus, zwei Jahre später sein zweites: »Atlantis - die Welt vor der Sintflut«. Muck sah den Delphinrücken als Folge einer kosmischen Katastrophe bis in 3000 Meter Tiefe abgesunken; Platons Atlantis sei dabei mitgerissen worden. Zwar waren die Bodenproben, die man im Azoren-Bereich vom Meeresgrund heraufholte, nach Meinung des schwedischen Ozeanologen Pettersson nur so zu deuten, daß dieses Gebiet seit mindestens 20 Millionen Jahren vom Meer bedeckt ist. (»Die Azorentheorie ist eine Leiche, endgültig tot.«) [6]
Doch hat Otto Muck deshalb nicht kapituliert. Er hat eine lange Reihe neuer, vielfach überraschender Gesichtspunkte in die nie abgerissene Diskussion gebracht, die ich indes nicht vorwegnehmen mochte. Es ist jedenfalls ein Vergnügen, seiner Beweisführung zu folgen, selbst und gerade dort, wo man Vorbehalte anmelden, Beweise nicht oder noch immer nicht als erbracht ansehen möchte. Ein faszinierender Mann, der ein faszinierendes Buch geschrieben hat: Der 1892 in Wien geborene Otto H(einrich) Muck studierte nach der Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg an der Technischen Hochschule in München. Er promovierte bei Sommerfeld, der auch Heisenbergs Lehrer war, nach der Aussage Heisenbergs »der Mann, der neben Niels Bohr meinen beruflichen Lebensweg vor allen anderen bestimmte«. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Muck im Peenemünder Raketenteam; er war einer der Erfinder des »Schnorchel« für die U-Boote. Im Laufe seines Lebens hat Muck rund 2000 Patente zuerteilt bekommen. Davon gingen knapp 40 in die Konstruktion der Methanschiffe ein, die für den griechischen Reeder Niarchos gebaut wurden. Muck war Berater von industriellen Großunternehmen, ein Techniker hohen Rangs, zugleich aus Neigung und Liebhaberei Künstler, ein talentierter Graphiker. Er starb 64jährig, am 7. November 1956. Die Vita dieses rastlosen, ungewöhnlichen Mannes allein signalisiert, daß man in diesem Atlantisbuch mit genialen Gedanken konfrontiert wird, einer in sich geschlossenen Kette beweisbarer Fakten, der die Phantasie des ernsthaften Erfinders und Realisators das Mögliche und das Wahrscheinliche, ihrem Rang entsprechend, zuordnet. Das seinerzeit rasch vergriffene Buch, das nicht die Aufmerksamkeit gefunden hat, die es verdient, liegt nun unter Einbeziehung neuer Erfahrungen und Ergebnisse in einer praktisch neuen Fassung vor.
Archäologische Fragen lassen sich heute im Zusammenwirken der naturwissenschaftlichen Disziplinen oft besser beantworten als früher, als die Fach- und Liebhaber-Archäologen unter sich waren. So kann man das Alter biologischen Materials heute mit Hilfe des radioaktiven Kohlenstoffs C 14 innerhalb sehr enger Grenzen bestimmen; der Amerikaner Libby hat für diese Methode 1960 den Nobelpreis erhalten. Holzkohlenreste aus Lascaux, der eiszeitlichen Bilderhöhle, vermochten auszusagen, daß das Feuer dort vor rund 16000 Jahren gebrannt hat. Die C-14-Datierung ist zweifellos eine moderne »Autorität«. Dennoch hat man wiederholt feststellen müssen, daß es Möglichkeiten gibt, auch hier zu falschen Ergebnissen zu gelangen. [7] Die mineralischen, die geologischen Uhren gar gehen um vieles ungenauer. Wie oft haben die Vorgeschichtler schon umdatieren müssen! Ich erinnere mich an einen Besuch im Museum von Malta. Als ich mir die Daten an den Schaukästen notieren wollte, sagte der alte Direktor bedauernd: »Das ist praktisch alles überholt. Man kommt gar nicht mehr nach.« Auch darum heißt es skeptisch sein, wenn jemand eine archäologische Zeitfrage mit der Bemerkung abtun will, das sei »längst und endgültig entschieden«. Hat nicht der große Arzt Rudolf Virchow mit dem ganzen Gewicht seines Wissens und seiner Erfahrung ein ablehnendes Machtwort gesprochen, als man ihm die eben erst entdeckten eiszeitlichen Malereien von Altamira zeigen wollte? Auch als der bescheidene Lehrer Fuhlrott, der das Schädeldach des von ihm entdeckten Neandertalers richtig erkannt hatte, um sein Urteil bat.
In beiden Fällen irrte die Autorität, erscheint die Ablehnung, die damals mit guten Gründen erfolgte, im nachhinein voreingenommen, ja engstirnig. Die Zeit, die neue Entdeckungen, neue Überlegungen, neue Erkenntnisse einbezieht, geht über die Argumente von gestern hinweg. Im Aufeinandertreffen von Beweis und Gegenbeweis, im Kampf um die Hieb- und Stichfestigkeit von Hypothesen bleibt auch heute und weiterhin vieles offen. Könnte es nicht sein, daß in die von den Ägyptern aufgezeichnete und von Platon weitererzählte Geschichte mehr eingegangen ist als die Erinnerung an ein einziges Ereignis, eine ganz bestimmte Katastrophe? Immer wieder läßt sich verfolgen, wie eine Tradition »umsattelte«, wie Personen und Ereignisse die Plätze tauschen. Es könnte sein, daß die Erzählung von Atlantis nicht nur aus den bisher bekannten Überlieferungen herrührt. Marinatos glaubte an eine »Legende aus ägäischer Tradition«, Spanuth sieht im Atlantis-Bericht eine Germania aus der Bronzezeit. Es könnte sein, daß beide recht und zugleich unrecht behalten, daß Atlantis hier wie dort gefunden wird. Möglicherweise ist die Erinnerung an jenen »Weltuntergang« auf dem Hintergrund einer sehr viel älteren, rund zehnfach älteren Überlieferung zu sehen, an ein Ereignis von tatsächlich kosmischer Größenordnung gebunden, einen entscheidenden Einschnitt im Kulturkalender der Menschheit.
Nehmen wir Platon, nahmen wir die dem Solon eröffneten Archive der ägyptischen Priester bei der Angabe der Zeit ernst, wenigstens der Größenordnung nach, dann hätte jene Menschheitskatastrophe, deren man sich nur noch schattenhaft zu erinnern vermochte, eben wirklich 9000 und nicht 900 Jahre vor Solon stattgefunden, dann wäre das eigentliche Atlantis damals - und wahrscheinlich dann wirklich im Atlantischen Ozean - untergegangen. Damit träte der im Buch von Otto H. Muck bei den Azoren geortete verlorene »Kontinent« Atlantis tatsächlich in ein neues Licht. Sicherlich ist es kein Zufall, wenn dies zu einer Zeit geschieht, da Menschen - vor noch nicht 40 Jahren - mit der Spaltung des Atoms ein neues gefährliches Feuer entdeckt und - vor noch nicht 10 Jahren- ihren Fuß auf den Mond gesetzt haben. Sieht man die Menschheitsgeschichte aus solcher Perspektive, wird man Antoine des Saint-Exupery besser verstehen, der 1934 geschrieben hat: »Man kann es kaum begreifen und weiß nicht recht, wieso der Wanderer Mensch die Gärten, die ihm die Natur hier bereitet hat, mit solcher Unbefangenheit bewohnt. Sie sind ja nur für so kurze Zeit bewohnbar, für ein Zeitalter der Erdgeschichte, für einen glücklichen Tag.« Die Kultur der Menschen, schrieb Exupery, sei »nur eine dünne Vergoldung, die ein Vulkanausbruch zerreißt, ein neues Meer wegwäscht, ein Sandsturm begräbt«.
Anmerkungen und Quellen
Dieser Beitrag von Ernst von Khuon (1915 - 1997) wurde dem Buch "Alles über Atlantis" von Otto Muck - erschienen 1976 im Econ-Verlag - entnommen, dessen Vorwort er mit dem Titel "Rätsel Atlantis. Träume + Funde + Fragen + Erfahrungen + Vermutungen" bildet. Die redaktionell bearbeitete Online-Wiederveröffentlichung des Textes bei Atlantisforschung.de erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Erben Ernst von Khuons.
Einzelverweise:
- ↑ Redaktionelle Anmerkung: Siehe dazu bei Atlantisforschung.de den Beitrag: "Die Maschine von Antikythera" (red)
- ↑ Redaktionelle Anmerkung: Siehe dazu bei Atlantisforschung.de den Beitrag: "Das minoische Atlantis des Dr. Angelos Galanopulos" von James Mavor Jr.
- ↑ Redaktionelle Anmerkung: Siehe dazu bei Atlantisforschung.de auch: "Jürgen Spanuth über 'Atlantis in der Ägäis'" (bb)
- ↑ Redaktionelle Anmerkung: Zur atlantologischen Archäologie in Andalusien vergleiche auch: "Atlantis-Kolonie Andalusien - Das Lebenswerk der Elena Maria Whishaw" (red)
- ↑ Redaktionelle Anmerkung: Hier irrte sich Ernst von Khuon. Das betreffende Zitat von Aristoteles bezieht sich tatsächlich auf Homer, nicht auf Platon. Dieser Irrtum ist allerdings sowohl nachvollziehbar als auch entschuldbar. Bei der vermeintlichen Atlantis-Ablehnung des Aristoteles handelt es sich nämlich um einen - seit mehr als 100 Jahren ungeprüft kolportierten - 'Wissenschafts-Mythos', wie der Atlantis-Experte Thorwald C. Franke 2010 im Rahmen einer umfangreichen Studie schlüssig und zweifelsfrei nachweisen konnte. Siehe: Thorwald C. Franke, "Aristoteles und Atlantis - Was dachte der Philosoph wirklich über das Inselreich des Platon?", BoD., März 2010
- ↑ Redaktionelle Anmerkung: Zu Petterssons Buch, das durchaus repräsentativ die heute im Mainstream der Geologie vorherrschende Meinung zu 'Atlantis im Atlantik' darlegt, siehe den Artikel: "Ein geologischer Meilenstein der Atlantisforschung - Hans Pettersson widerlegt 1944 Atlantis im Atlantik" (April 2010) von Thorwald C. Franke, welcher die Auffassung des schwedischen Ozeanographen ohne Wenn und Aber teilt. Aus Sicht grenzwissenschaftlicher, alternativer bzw. devianter Forschung ist Petterssons Auffassung dagegen äußerst fragwürdig. Siehe dazu bei Atlantisforschung.de diverse Beiträge zur geologischen Diskussion versunkener Landmassen im Atlantik.
- ↑ Redaktionelle Anmerkung: Zur Kritik der archäologischen Datierungsmethoden siehe bei Atlantisforschung.de die Beiträge in der Sektion: "Das 'Kreuz' mit den Datierungen" (red)
Bild-Quellen:
- 1) Bild-Archiv Familie von Khuon-Wildegg
- 2) Bild-Archiv Atlantisforschung.de
- 3) Wikimedia Commons, unter: File:Santorin Guillaume-Antoine Olivier.jpg (Bildbearbeitung durch Atlantisforschung.de)
- 4) Atlantipedia.ie, unter: Spanuth, Dr. Jürgen (Bild-Bearbeitung durch Atlantisforschung.de)
- 5) Bild-Archiv Atlantisforschung.de
- 7) Thorwald C. Franke, "Ein geologischer Meilenstein der Atlantisforschung - Hans Pettersson widerlegt 1944 Atlantis im Atlantik "; bei Atlantis-Scout.de
- 8) Bild-Archiv Familie von Khuon-Wildegg